
Zwischen Bildkreation und Bildkritik
Vor etwa dreißig Jahren erschien in „Christsein heute“ eine Artikelserie zum Christusbild in der Kunst von Norbert Schnabel. Ein paar Jahre später lud der Autor und damalige Redakteur der FeG-Zeitschrift in Gemalter Glaube dazu ein, die „christliche Symbolik“, so der Untertitel des Buchs, in den Bildern von Caspar David Friedrich zu studieren.
Veröffentlichungen dieser Art, die eine Brücke zwischen dem christlichen Glauben und der bildenden Kunst schlagen, gibt es im deutschsprachigen Raum wahrlich nicht zu viele. Eine Bresche schlug hier einst Francis A. Schaeffer mit Kunst und die Bibel (Art and the Bible, 1973). Einige Jahre später folgte sein Wie können wir denn leben? (How Shall We Then Live?), in dem es auch viel um Kunst geht. Zumindest in Deutschland sind nur wenige dem Gründer von „L’Abri“ gefolgt.
Gottesbilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst (C.H. Beck, 2024) von Johann Hinrich Claussen füllt daher gewiss eine Lücke im christlichen Buchmarkt. Der Theologe und Kulturbeauftragte der EKD führt den Leser durch „eine Art Ausstellung“ (S. 15): in zwölf „Sälen“ oder Kapiteln stellt er ausgewählte Bilder, Skulpturen und andere Kunstwerke aus fast zwei Jahrtausenden künstlerischen Schaffens der Christenheit vor: von den ersten Christusbildern über die „Antiken Bilderwelten“ und die Ikonen in Byzanz bis hin zu den „Sehnsuchtsbildern der Romantik“ und die „Christliche Kunst in der Moderne“. Dazwischen erläutert Claussen Werke des Mittelalters und der Renaissance, der Reformation und des Barocks.
Dem Autor gelingt es, „größtmögliche Vielfalt vor Augen [zu] führen: Uraltes und Hochmodernes, Unbekanntes und Vertrautes, Meisterwerke und Volkskunst, Schönes und Hässliches, Hinreißendes und Problematisches“ (S. 16) – all das findet sich in seinem sehr kenntnisreichen, nie langweilig geschriebenen und reich illustrierten Buch.
Schaugenüsse lockten zur Bekehrung
Natürlich entdeckt der Leser so manche bekannte Perle der christlichen Kunstgeschichte wie den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der im elsässischen Colmar hängt. Der Christus dieses Meisterwerks des frühen 16. Jahrhunderts ist ein „Inbild des Grauens“, alles an ihm „ist hässlich“. Die bis dahin „größte Kreuzigungsdarstellung“ überhaupt „ist bis heute die erschreckendste geblieben. Nichts an der Passion Christi wird hier gemildert. Mit einer nie gesehenen Radikalität wird sie mit den Mitteln eines grotesken Realismus krass ausgestellt“ (S. 162).
Im Saal zur Reformationszeit zeigt Claussen gut, wie durch die noch junge Buchdrucktechnik und die Luther-Stiche aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Älteren der Reformator gleichsam zur „Massenware“ wurde. Zahllose Porträts „machten Luther zur bis dato meistporträtierten Person der Geschichte“ (S. 174). Zudem visualisierten Cranachs „Gesetz und Gnade“-Bilder die Lehre Luthers. Claussen weist jedoch darauf hin, dass schon Jahre vor dem Deutschen ein anonymer Grafiker dieses Motiv mit zwei Bildhälften um den Lebensbaum herum für den französischsprachigen Markt geschaffen hatte. Der Collage-Stil des Holzstichs, die „enge Verbindung von Bild und Text“, war „ein originärer Beitrag des Protestantismus zur christlichen Bildgeschichte“ (S. 179).
Die katholische Reaktion auf die Reformation bestand in „Triumph und Überwältigung“, so eingangs im neunten Saal der „Barocken Bildermissionen“ (S. 187). Ging es den Protestanten eher um Bibel und Bildung und ließen sie die Bilder den Worten dienen, so setzte Rom ganz auf visuelle Beeindruckung. Claussen spricht von einer „nochmaligen Aufwertung der Bilder“ während der Gegenreformation. Die Kritikpunkte der Reformatoren wie das Mönchtum, die Eucharistie und die Anbetung Marias wurden „zum Identitätsmerkmal der katholischen Konfession erhoben“ und „mit erheblichem Aufwand und Können ins Bild gesetzt“ (S. 187). Die katholischen Werke des 17. Jahrhunderts wie von Rubens boten „Schaugenüsse, sprachen die Gefühle an, führten Dramen auf, reizten zur Reflexion, lockten zur Bekehrung“. Der Autor resümiert: „Dieser Bildermacht hatte der Protestantismus wenig Vergleichbares entgegenzusetzen.“ (S. 188)
Die Logik des allmächtigen Reliquienglaubens
Es wundert etwas, dass Claussen Michelangelo und Rembrandt, diesen beiden Großen der christlichen Kunst, eher wenig Raum widmet. Der Italiener wird von ihm sogar nur eher beiläufig erwähnt. Offensichtlich ging es dem Autor auch darum, eher wenig bekannte Bilder und Skulpturen vorzustellen, die aber epochemachende Wirkung hatten. Dazu gehört die Statue der Heiligen Fides (frz. Sainte Foy) in Südfrankreich.
Im frühen 4. Jahrhundert soll Fides, ein vornehmes, junges Mädchen, während der Christenverfolgungen einen grausamen Märtyrertod gestorben sein. Ihre Überreste gelangten Jahrhunderte später in ein Kloster und wurden ab etwa 900 in einer reich mit Gold und Edelsteinen geschmückten Ganzkörperfigur aufbewahrt: eine prächtige Statue eines Menschen als Reliquiar. Claussen spricht daher von der „Geburt der westeuropäischen Skulptur aus dem Geist der Reliquienverehrung“ (S. 103).
Die Überreste der Heiligen „sollten nicht mehr allein in Altäre eingelassen werden, sondern selbst sichtbar werden. Dazu steckte man sie entweder in edle Schaubehälter oder man schuf um sie herum Bildwerke, die ihnen wieder einen ganzen Körper gaben.“ In einem nächsten Schritt hat sich dann „das dreidimensionale Bildwerk von der Reliquie gelöst“. Es entstanden Skulpturen und Plastiken auch ohne das Reststück eines Heiligenkörpers. „Diese Entwicklung christlicher Bildhauerkunst aus dem Geist des Reliquienkults muss sich für damalige Verhältnisse rasend schnell vollzogen haben“, so Claussen. An ihrem Beginn stand nicht eine „ästhetische Idee“, sondern die „Logik des allmächtigen Reliquienglaubens“ (S. 104-105).
Einer evangelischen Leserschaft dürften auch das „Das Jesusbild der Nonne Faustina“ (S. 250) und seine Geschichte kaum bekannt sein. Dabei sucht der Kult um dieses Gemälde, das heute im litauischen Vilnius hängt, seinesgleichen. Ab 1931 will die polnische Nonne Faustyna Kowalska verschiedene Visionen erhalten haben. Jesus habe sie aufgefordert, ein ganz bestimmtes Bildnis von ihm anzufertigen. 1933 wurde Kowalska in das Ordenskloster in Vilnius versetzt, das damals zu Polen gehörte. Nach den Eindrücken der Mystikerin fertigte der Künstler Eugeniusz Kazimirowski 1934 das „Gnadenbild des Barmherzigen Jesus“. Neben diesem Gemälde gibt es noch andere, später angefertigte Darstellungen der Vision wie von Adolf Hyła, das auch in Claussens Buch abgebildet ist.
Der Jesus von Kazimirowski bzw. Hyła „zürnt und straft nicht, er ist wie eine liebevolle Mutter, der man sich jederzeit ohne Angst anvertrauen kann. […] Es ist sozusagen ein evangelischer Katholizismus“ (S. 252). Der theologische Hintergrund des Bildes ist der katholischen Herz-Jesu-Kult, der sich ab dem 17. Jahrhundert ausbreitete. Er gründet sich nicht auf die Bibel, sondern auf neuen Offenbarungen. So machte Jesus auch Kowalska angeblich neue Zusagen: „Ich verspreche, dass die Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch, schon hier auf Erden, den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes“. Heute ist „dieses Gnadenbild in Polen allgegenwärtig“ (ibid.), und Reproduktionen des Kazimirowski-Originals hängen in fast jeder katholischen Kirche Litauens.
Angesichts dieser gnadenspendenden Bilder im Katholizismus wird die „fundamentale Bildkritik“ (S. 171) der sog. Bilderstürmer in der frühen Reformationszeit verständlich. Claussen zu ihrem grundlegenden Anliegen: „Niemand sollte mehr vor Bildern niederknien, sie anbeten, für sie bezahlen, sich von ihnen verführen lassen“ (ibid.). Sehr ausgewogen schildert er, dass es anfangs zwar zu gewalttätigen Ausschreitungen kam, aber bald zur „amtlichen Durchsetzung des Bilderverbots“ (ibid.) übergangen wurde.
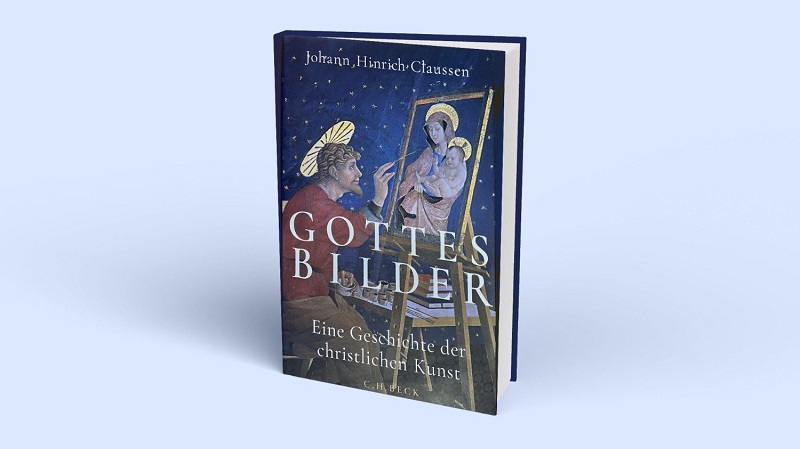
In der theologischen Bildkritik waren sich die Reformatoren im Grunde einig. Martin Luther sprach sich aber immer für Mäßigung aus. Claussen über den Grundsatz, der sich in den lutherischen Territorien durchsetzte: „Solange man Bilder nicht als Mittler zum Göttlichen missverstand und sie verehrte, ihnen also keine religiöse Macht zusprach, mochten sie bleiben, wo sie waren. […] Sie hatten nur ihre bisherige Aura und Funktion verloren.“ (S. 173) Sehr gut weist er aber auch darauf hin, dass sich die „konsequente Bilderlosigkeit“ in der Schweiz und bei den Reformierten „aus der Situation als verfolgter Minderheit [ergab]. Von der bilderseligen Papstkirche brutal bedrängt, wählte man den Verzicht auf alle Bilder als sichtbares Konfessionsmerkmal“ (S. 174).
Gleichsetzung von Bild und Bibel
Ausführlich schildert Claussen den „epochalen Streit“ (S. 77) um die Gottesbilder im Byzantinischen Reich. Die „bilderfeindliche Kulturrevolution“ begann im 8. Jahrhundert mit Kaiser Leo III. „Er glaubte, dass man Göttliches nicht mit menschlichen Mitteln darstellen könne und dürfe. Deshalb ließ er alle frommen Bildwerke verbieten, zerstören oder wegschaffen.“ (S. 77) Die Bilderverehrer schlugen zurück und verdammten beim Zweiten Konzil von Nicäa 787 den Ikonoklasmus als häretische Neuerung. Ein halbes Jahrhundert später konnte Kaiserin Theodora das Recht auf Bilderverehrung endgültig durchzusetzen. Eine wahrscheinlich um 1400 entstandene „berühmte Ikone feiert diesen Sieg im Bürgerkrieg gegen die Bilderstürmer. Sie trägt den Titel ‘Triumph der Orthodoxie’“ (S. 79).
Neuere Forschungen, so Claussen, zeigen nun aber: „Von einem epochalen Konflikt blieb am Ende nicht viel übrig“ (S. 81). Einige Historiker gehen heute davon aus, dass „eine von oben dekretierte Kulturrevolution oder ein Bürgerkrieg“ schlicht nicht stattgefunden haben (S. 82). „Flächendeckende Bilderstürme hat es im antiken und mittelalterlichen Christentum höchstwahrscheinlich nicht gegeben“ (S. 84). Die Ikonenverehrer „verstanden sich gut auf Bildpropaganda“. Sie setzten den Streit groß in Szene und machten aus ihm einen Konflikt zwischen Gut und Böse. In einer Zeichnung werden z.B. „Ikonoklasmus und Passion Christi gleichgesetzt“. Die Ikonenkritiker wurden „als jüdische Christusfeinde dargestellt“ (ibid.) – wahrlich ein Schlag unter die Gürtellinie der theologischen Gegner.
Die strenge Forderung, dass Bilder verehrt werden müssen, setzte sich im Osten durch und prägt bis heute die orthodoxe Frömmigkeit und Gottesdienste, die ohne Ikonen nicht denkbar sind. Den Anfang bildete auch hier der antike Reliquienkult. In heiligen ‘Resten’ „sollte die Kraft und Gegenwart des Heilands und der Heiligen dinglich da und wirksam sein. Irgendwann […] scheint der Brauch aufgekommen zu sein, die sterblichen Überreste von heiligen Personen mit Bildern von diesen zu verbinden“ (S. 85). An Ikonen wurde und wird geglaubt, „weil sich in ihnen etwas Göttliches als gegenwärtig“ erweist; weil sie „irdische Spiegel einer himmlischen Wirklichkeit“ sind – „sie können Wunder vollbringen, Menschen heilen, ganze Landstriche vor Seuchen schützen, feindliche Armeen besiegen“. Sie sind letztlich keine Kunstwerke, die es zu betrachten gilt – „sie wollen verehrt sein“ (S. 87).
Ein lokal verehrter Wettergott
Eingangs erörtert Claussen das „spannungsgeladene ‘Zugleich’ von Bildkreation und Bildkritik“ (S. 19). Den tiefen Sinn des Bilderverbots sieht er „in einer tiefen Ehrfurcht vor der Überweltlichkeit des Ewigen und damit in einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber allen Versuchen, Gott zu verbildlichen und zu verdinglichen“ (S. 31). Im Bilderverbot könne sich außerdem eine „befreiende, machtkritische Wirkung entfalten. Denn feste Gottesbilder sind in Gefahr, Instrumente menschlicher – politischer, religiöser, sozialer – Herrschaft zu werden.“ (ibid.)
Der geichsam späte Triumph der protestantischen Bilderstürmer hat aber auch zu einer ästhetischen Verarmung des Kirchenraumes geführt: „Man besuche nur einen zeitgenössischen Kirchenbau – egal ob katholisch oder evangelisch –, und man wird kaum noch Bilder finden“ (S. 19). Der erneuerte Innenraum der katholischen St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin ist ein krasses Beispiel dieser überzogenen Kargheit.
Allerdings zeigt sich auch gerade zu Beginn des Buchs eine grundlegende Schwäche in der Begründung des Bilderskepsis. „Jahwe scheint ursprünglich ein lokal verehrter Wettergott gewesen zu sein, der sich dann aber zum Hauptgott Israels entwickelte“ (S. 24), schreibt Claussen. Dessen „überwältigende Stärke“ haben sich die Israeliten „durch das Bild eines vitalen, kraftstrotzenden, fruchtbaren Jungstiers vorstellig“ gemacht (ibid.). „Israel unterschied sich im Glauben über lange Zeit kaum von seinen Nachbarn“ (S. 22).
Erst im Zuge des babylonischen Exils sei die „bis dahin menschheitsgeschichtlich einmalige Kritik an Gottesbildern“ lautgeworden. Ein „namenloser Prophet, dessen Verse sich im Jesaja-Buch finden“, sei der „erste konsequente Botschafter dieses neuen Glaubens“ gewesen (S. 29). Dessen „unerhörte Entzauberung aller Götterbilder“ (er zitiert Jes 44,9-17) sei ein „polemische Verriss“, den Claussen aber als nicht „ganz fair“ bewertet (S. 31).
Warum nicht ganz fair, wenn doch die tiefe Ehrfurcht vor der Überweltlichkeit des Ewigen (s.o.) auf dem Spiel steht? Claussen verwässert die radikale Kritik an Gottesdarstellungen, wenn er – dem historisch-kritischen Mainstream folgend – von einer Evolution der Gottesvorstellung ausgeht. „Menschen können gar nicht anders, als ihren Glauben in Bilder zu fassen“. Gleichzeitig sähen sie sich gezwungen diese „immer wieder [zu] zerstören, damit sie nicht an die Stelle des Geglaubten treten“ (S. 31).
Claussen gibt dem Leser also einen guten Einstieg in die Geschichte der christlichen Kunst. Eine theologisch begründete evangelische Ethik, die klare Grenzen zwischen Bildkreation und Bildkritik aufzeigt, sollte man in Gottesbilder jedoch nicht suchen.


